Vertrauen ist Geld wert
Meist können wir es nicht einmal anfassen, weil es nur aus digitalen Zeichen besteht. Und trotzdem trauen wir ihm beim Wirtschaften und in unseren Träumen alles zu: dem Geld. Eine geschichtliche Spurensuche mit Begriffsdefinitionen, die in die Zukunft weisen.
Text: Stephan Lehmann-Maldonado / Illustrationen: Grafilu | aus dem Magazin «ZH» 1/2021
Klingeling. Das MoneyMuseum ist diskret in einem Wohnhaus am Zürichberg untergebracht. Die Mitarbeiterin Ursula Kohler öffnet dem Besucher die Tür – und korrigiert gleich die Erwartungen: «Wir zeigen keine klassischen Münzsammlungen mehr. Wir verstehen uns als Museion im Sinn der griechischen Antike, also als Treffpunkt, um sich über Ideen auszutauschen.»

Trotzdem wandern die Augen des Eintretenden schnell zur Vitrine. Da finden sich Artefakte aus Muscheln, Schnecken, Federn, Salz, Tee, Kakao – eine faszinierende Sammlung traditioneller Zahlungsmittel aus Afrika, Asien und Europa. Ursula Kohler zeigt auf Muschelgeld aus Papua-Neuguinea: Seit Menschengedenken zirkuliert das sogenannte «Tabu» durch Hände. Korrekterweise müsste man von «Schneckengeld» sprechen, denn dieses Zahlungsmittel besteht meist aus Meeresschnecken. Die Gehäuse waren äusserst selten, die Verarbeitungszeit dauerte wochenlang. Wen wundert’s, dass keine Fälschungen bekannt sind.
Tabus dienten zwar als Zahlungsmittel, aber mehr noch als Mitbringsel. «Sie waren Teil von Gabengesellschaften. Eingebettet in Riten, bildeten sie den sozialen Kitt», erläutert Kohler. Man schenkte sich die Kostbarkeiten zum Beispiel bei Hochzeiten, Beerdigungen, Geburten, Zeremonien. «Es ging nicht ums äquivalente Bezahlen, sondern um den gesellschaftlichen Ausgleich», betont Kohler. Man investierte ins gegenseitige Vertrauen. So exotisch die beliebte Schneckenwährung anmutet: Sie ist in Papua-Neuguinea bis heute im Umlauf.
Waren am Anfang die Schulden?
Es braucht weniger Fingerspitzengefühl, um mit Franken, Euros und Dollars umgehen zu können. Längst ist unser heutiges Geld so genormt, dass sich jede Verpflichtung, jedes Gut und jede Leistung damit präzise quantifizieren lässt. Jedes wirtschaftliche Schaffen des Menschen wird in Geld gemessen und zum Bruttoinlandprodukt (BIP) aufsummiert, das als Wohlstandsindikator gilt. Dahinter steckt eine Denkhaltung, die ein geflügeltes Wort auf den Punkt bringt: «Was nichts kostet, ist nichts wert.»
Doch auch wenn Geld für uns alltäglich geworden ist und seine Funktionen als Tauschmittel, Wertaufbewahrungsmittel und Masseinheit für eine arbeitsteilige Wirtschaft unentbehrlich scheinen: Die Wissenschafter streiten sich immer noch darüber, wie es entstanden ist. In den meisten Lehrbüchern beginnt die Geldgeschichte mit dem Tauschhandel. Demnach überreichte der Viehzüchter sein Kalb dem Ackerbauern gegen eine Ladung Weizen oder andere Güter. Das klingt plausibel. Doch was, wenn der Weizen zum Kaufzeitpunkt nicht erntereif war? Wollte der Viehzüchter den Deal doch unter Dach bringen, gab er sein Kalb her, verlangte dafür aber später umso mehr Weizen. Mit anderen Worten stünde der Kredit – das Vertrauen ins Versprechen des Handelspartners – am Anfang unseres Geldsystems. Genau das behauptete der kürzlich verstorbene US-Anthropologe David Graeber in seinem Buch «Schulden: Die ersten 5’000 Jahre».
Geld ergebe sich blindlings, niemand habe es erfunden. Sein Aufkommen sei «bedingt durch das Abhängig-Werden ganzer Gemeinwesen davon, dass ihre Einwohner voneinander kaufen und einander verkaufen können», schreibt der Philosoph Eske Bockelmann in seinem neuen Buch «Das Geld: Was es ist, das uns beherrscht». Als Tauschmittel sei Geld «virtuell von seinem Anfang an».
Krösus erfindet ein Münzsystem
Wenn sich Metallscheiben und Papierscheine durchgesetzt haben, lag es wohl vor allem daran, dass sie praktischer waren als Federn und Schnecken. Das erkannte der reiche König Krösus von Lydien – ein Gebiet in der heutigen Türkei – vor über 2’500 Jahren. Deshalb liess er Silber- und Goldklumpen mit verschiedenen Gewichten abwägen. Darauf schlug man das königliche Siegel. Das erste Münzsystem mit verschiedenen Recheneinheiten entstand. Und die runden Stücke sind gut gealtert: Ursula Kohler klaubt aus einer kleinen Schatzkiste im MoneyMuseum eine Münze hervor, die einen Löwen zeigt – eine Originalprägung von Krösus.
Die Römer brachten das erste ausgeklügelte Währungssystem nach Zürich. Einige Exemplare davon darf man im MoneyMuseum anfassen. Kohler erklärt: «Der Krieg der Römer gegen Hannibal machte die Denar-Reform notwendig. Alle grossen Veränderungen des römischen Münzwesens lassen sich auf Kriege zurückführen.» Leerten sich die Staatskassen, senkte Rom jeweils den Silbergehalt des Denars, was ihn schwächte. Immerhin, er kursierte fast 500 Jahre lang als Leitwährung. In der Schatzkiste des MoneyMuseums fallen aber auch grosse Münzen auf. «Die Taler erleichterten den Fernhandel», erzählt Kohler. Eine der ersten dieser Silbermünzen stellten die Berner anno 1493 her. Jahrelang tüftelte der Zürcher Hans Vogler an einem revolutionären Walzprägewerk für die Tiroler Münzstätte. 1569 erhielt er dafür ein Patent vom deutschen Kaiser Ferdinand I. – doch die Kassen klimperten bei anderen. Benannt nach der böhmischen Münzstätte Joachimsthal zogen die Taler später in die weite Welt hinaus. So finden sich im MoneyMuseum sogar Taler aus China nach europäischem Vorbild. «Bis heute leben die Taler im Dollar weiter», erfährt man von Kohler.
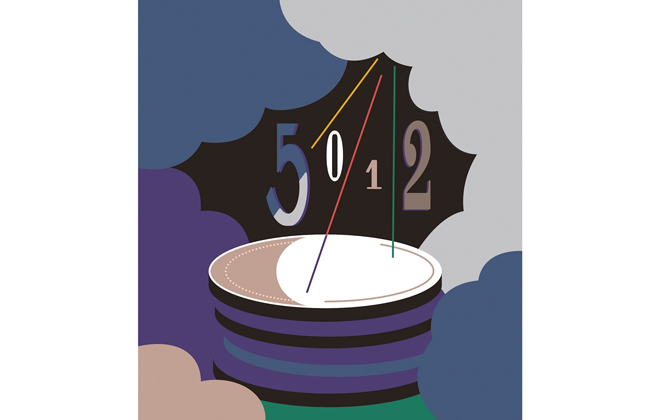
Das Experiment mit dem Papier
Die schmucken Silbermünzen hatten jedoch eine Kehrseite: Die Händler mussten schwere Geldsäcke schleppen. Im Spätmittelalter lagerten sie ihre Münzen deshalb bei Geldwechslern. Diese sollten das Vermögen bunkern. Im Gegenzug erhielten die Kaufleute eine Quittung – einen Vorläufer unserer Banknoten. Wer einen solchen «Wechsel» erwarb, vertraute der Ehrlichkeit des Herausgebers.
Noch schlauer stellten es die Chinesen an. Der Venezianer Marco Polo spottete darüber, dass europäische Alchimisten versuchten, Gold hinzuzaubern, während Chinas Regenten einfach Papier zu Geld machten. «Münzen besassen einen Materialwert. Dagegen verkörperten Banknoten bloss ein Zahlungsversprechen. Und sie waren in der Herstellung günstiger», betont Tobias Straumann, Professor der Universität Zürich und Mitverfasser des Buchs zum 150-Jahr-Jubiläum der Zürcher Kantonalbank. «Geld wurde zur reinen Vertrauenssache.»
Europaweit gelang es zuerst dem Banker Johan Palmstruch in Schweden, die Regierung zur Gründung einer Art Zentralbank zu überreden. Über diese druckte er 1661 erste europäische Banknoten, ohne sie wesentlich mit Edelmetall zu hinterlegen. Das Experiment endete mit einem monetären Drama, wie es China bereits kannte: einer massiven Inflation. Nur knapp entging Palmstruch der Todesstrafe. Ähnliche Erfahrungen machte der schottische Mathematiker John Law, der die Chance erhielt, das hoch verschuldete Frankreich zu sanieren. 1716 rief er eine Zentralbank ins Leben und gab Papiergeld heraus. Mit verblüffendem Erfolg: Die Druckmaschinen liefen auf Hochtouren, die Wirtschaft blühte auf. Das Vertrauen in den Herausgeber schien dem Volk zu genügen – bis es Verdacht schöpfte. Da zerfiel der Wert des Papiergelds. John Law konnte sich gerade noch rechtzeitig aus dem Staub machen.
Daraufhin verschwand das Konzept des Papiergelds bis ins 19. Jahrhundert in der Schublade. Es herrschte die Meinung vor, Metallgeld sei das «wahre» Geld- und Banknoten und Buchgeld lediglich ein Ersatz dafür. Das Recht für die Geldherstellung war Kaisern, Königen und Fürsten vorbehalten. Unzählige Münzsorten konkurrierten. In der Schweiz versuchte Napoleon 1799 über die Helvetische Republik eine einheitliche Währung namens «Franken» zu etablieren. Er scheiterte. Dies gelang erst dem Schweizer Bundesstaat, der 1848 entstand. 1850 zog er rund 66 Millionen alte Münzen ein. Nach Gepräge und Metallwert zählte man 860 Sorten!

Die ZKB als Notenbank
«Die Zürcher Kantonalbank gehörte damals zum Kreis der Notenbanken, die Papiergeld herstellen durften», sagt Tobias Straumann. Das Geschäftsfeld brach weg, als die Nationalbank 1907 ihren Betrieb aufnahm. Zentralbanken besitzen zwar das Notenmonopol, aber sie sind nicht die einzige Geldquelle. Auch Banken können Geld schöpfen. Mit jedem Kredit entsteht in den Geschäftsbüchern neues Geld: Die Buchgeldmenge steigt. Und im Zuge der Digitalisierung braucht es dazu nicht einmal mehr Register. Ein elektronisches Zeichen genügt. «Damit hat sich das Geld entmaterialisiert», resümiert Jürg Conzett, Gründer des MoneyMuseums, in der Bibliothek, die zum Schmökern und Nachdenken einlädt.
«Das kapitalistische Geldsystem hat sich erst ab dem 17. Jahrhundert herangebildet», berichtet Conzett: «Seither spielt Geld beim Wirtschaften nicht mehr eine Nebenrolle, sondern die Hauptrolle.» Dabei sei unser Geld im wahrsten Sinn des Wortes «wertlos». Immense Teile der Geldmenge ruhten nur auf elektronischen Konten und würden kaum bewegt. «Das System funktioniert, solange ihm die Menschen vertrauen», glaubt Conzett.
Nach der Finanzkrise (2008) und während der Coronakrise (2020) haben die Notenbanken weltweit mehr Geld denn je in die Märkte gepumpt. Kann das gut gehen? «Unsere Währungen reflektieren das Vertrauen in die Macht der Regierung», antwortet David Marmet, Chefökonom Schweiz der Zürcher Kantonalbank. Und weiter: «Wenn der Franken im Verhältnis zum Euro und zum Dollar aufwertet, zeugt dies vom Vertrauen in die direkte Demokratie, die verlässliche Wirtschaftspolitik und die tiefe Staatsverschuldung.» Ein unabhängiger Staat wie die Schweiz könne Schulden zurückzahlen, indem er Geld produziere oder die Steuern erhöhe.
Fakt ist: Die Nationalbank peilt eine geringe Inflation zwischen null und zwei Prozent an. «Das wirkt wie Öl im Wirtschaftsgetriebe. Sonst würden die Menschen das Geld horten, statt zu investieren und auszugeben», begründet Marmet. «Solange nicht rasch steigende Löhne die Güterpreise hochschnellen lassen, sehe ich aber keine Gefahr für eine galoppierende Inflation.»
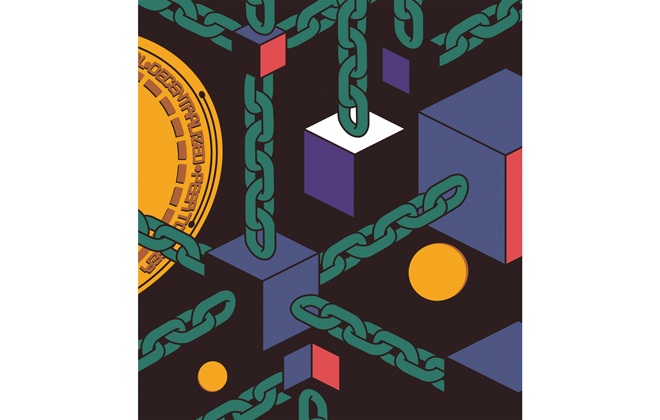
Die Währung der Zukunft
Trotzdem gibt es Skeptiker, die den Notenbanken misstrauen. Einige von ihnen setzen auf Altbewährtes wie Silber und Gold. Andere wetten auf digitale Währungen wie den Bitcoin, der sich dem Griff der Notenbanker entzieht. «Der Bitcoin hat noch Kinderkrankheiten», warnt Marmet: «Für Zahlungen ist er nicht schnell genug. Und die elektronischen Bestätigungen verschlingen so viel Energie, dass dies umweltpolitisch nicht sinnvoll wäre.» Marmet geht davon aus, dass sich längerfristig etwa drei bis vier Kryptowährungen durchsetzen könnten. Doch sie bekommen Konkurrenz: Die Zentralbanken wollen die elektronischen Währungen nicht den «Rebellen» überlassen. Sie entwickeln eigene elektronische Währungen. Die Nase vorn haben China und Schweden – wie einst beim Papiergeld.
Von digitalen Währungen zu unterscheiden sind bargeldlose Zahlungsmittel, die im Aufwind sind. Die Bandbreite reicht von Smartphone-Apps wie ZKB TWINT, Apple Pay und Samsung Pay bis hin zum kontaktlosen Bezahlen mit Plastikkarten. Diese Möglichkeiten sind genauso sicher wie Bargeld. Doch auch hier kommt man nicht um die Vertrauensfrage herum, meint Marmet: «Nutze ich die Schweizer Technologie von TWINT, die unserem strengen Datenschutzgesetz untersteht, oder lasse ich mir von ausländischen Mitbewerbern in die Karten schauen?»
Münzen, Banknoten, Geld in Bits und Bytes: Je nach Verwendungszweck schneidet die eine Geldform besser ab als die andere. Es ist denkbar, dass sie in Zukunft nebeneinander existieren wie die Malerei und die Fotografie. Bedenkenswert und definitiv entmaterialisiert ist aber auch der Satz von Jürg Conzett beim Abschied im MoneyMuseum: «Nicht alles Wertvolle braucht einen Preis.»

Goldvreneli
Goldvreneli
Zwischen 1897 und 1949 wurden 58,6 Millionen «Goldvreneli» geprägt. Die 20-Franken-Münze diente als Zahlungsmittel. Weil sie nicht die hehre Landesmutter Helvetia, sondern das «frivole» Vreneli (Kommentar der damaligen Jury) abbildete, brach sie in der internationalen Münzenwelt alle Tabus. Beim Volk kam das gut an. Die Münzen mit 90 Prozent Goldgehalt sind bis heute beliebte Geschenke.
Fiatgeld
Fiatgeld
«Fiat lux», so spricht Gott in der lateinischen Bibel. «Es werde Licht!», heisst es auf Deutsch, «Und es wurde Licht.» Ganz ähnlich entsteht Fiatgeld, nämlich aus dem Nichts. Seinen Wert erhält es, indem es den Wert – oft durch den Staat – zugesprochen bekommt. Die Herstellkosten einer Hunderternote betragen nur 40 Rappen. Der grösste Teil des Geldes ist heute entmaterialisiert und existiert nur noch digital.
Modern Monetary Theory
Modern Monetary Theory
Die AHV verdoppeln? Gemäss Modern Monetary Theory (MMT): Kein Problem. Die US-Ökonomin Stephanie Kelton sagt: «Staaten mit eigener Währung können Rentnern so viel zahlen, wie sie wollen. Denn sie haben das Monopol, Geld zu schöpfen.» Schulden sind ein Problem für Private, aber nicht für den Staat. Dieser kann immer Geld schaffen. Demnach entsteht Inflation nur, wenn die Wirtschaft nicht genug produktiv ist.
Blockchain
Blockchain
Diese Technologie muss man sich als Archiv vorstellen. Es hält elektronisch fest, wem was gehört. Jede Transaktion wird in einem Datenblock («Block») festgelegt. So reiht sich ein Datenblock an den anderen, womit eine Kette («Chain») entsteht. Speziell: Die Daten werden kryptografisch verschlüsselt und dezentral gespeichert, was sie vor Manipulation schützt. Somit ist stets ersichtlich, wie jemand zu Geld oder einem Recht gekommen ist.
E-Franken
E-Franken
Kryptowährungen wie der Bitcoin sind als Alternative zum Franken, Euro, Dollar etc. entstanden. Jetzt treiben Zentralbanken eigene digitale Währungen voran – Central Bank Digital Currencies, kurz CBDC. China ist weit fortgeschritten, Schweden experimentiert mit der e-krona. Die Schweizer Nationalbank hat noch keine Pläne für einen E-Franken präsentiert. Digitales Geld verhindert Steuerhinterziehung und Schwarzgeld, verschlingt jedoch Strom.
Kryptowährung
Kryptowährung
Bald nach der Finanzkrise ist 2009 die erste Kryptowährung auf den Markt gekommen: der Bitcoin. Die Erfinder versteckten sich hinter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto. Der Bitcoin begann als kryptografisch verschlüsselte Zahl, basierend auf der Blockchain-Technologie. Er hat viele Nachahmer gefunden: Per August 2020 zählte man 6’000 Kryptowährungen. Gemeinsam haben sie, dass sie ohne Bank und Zentralbank funktionieren.

