Globalisierung im Gegenwind
Der anhaltende Konflikt zwischen den USA und China, die Pandemie und der Ukraine-Krieg haben in den vergangenen Jahren die Schattenseiten der Globalisierung und die teilweise hohe Abhängigkeit von ausländischen Produzenten offengelegt.
Text: Martin Weder
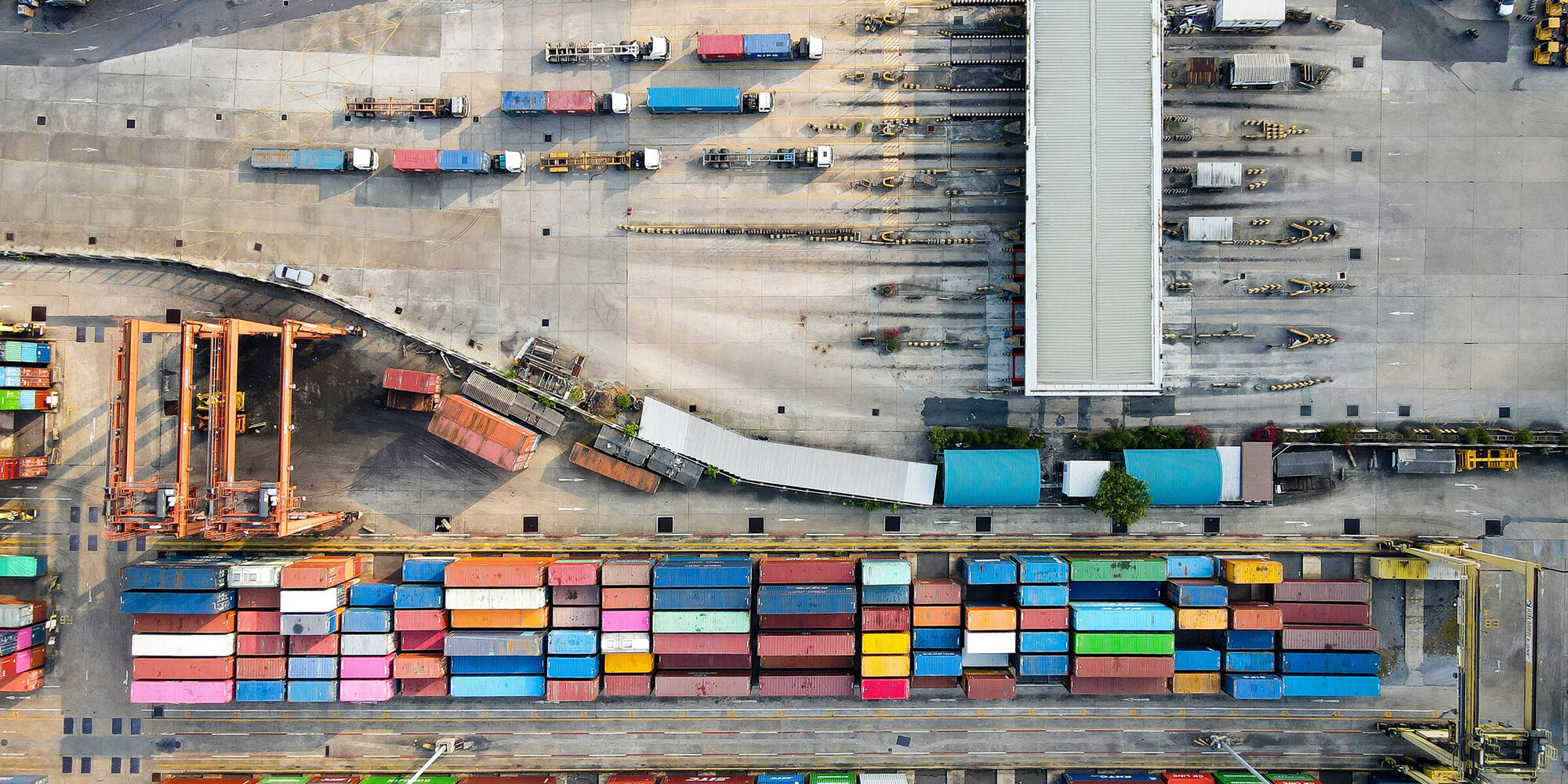
Globalisierung schafft Wohlstandsgewinne
Begünstigt durch neue Technologien im Kommunikations-, Informations- und Transportwesen sowie durch den Abbau von Handelshemmnissen haben die internationale Verflechtung und der weltweite Austausch von Waren, Dienstleistungen und Kapital in den vergangenen Jahrzehnten markant zugenommen. So ist das globale Handelsvolumen seit 1960 um den Faktor 20 gestiegen und ist damit mehr als doppelt so stark gewachsen wie die Weltwirtschaft. Die zunehmende Arbeitsteilung und die wachsende Bedeutung des Handels gingen mit enormen Produktivitäts- und Wohlstandsgewinnen einher. So wurde auch der rasante und beeindruckende Aufstieg Chinas stark von der Integration in die globalen Wertschöpfungsketten getrieben. Gemäss Zahlen der Weltbank wurden in den letzten 40 Jahren allein in China 800 Mio. Menschen aus der Armut befreit. Heute ist China die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt und für rund 30 Prozent der globalen Industrieproduktion verantwortlich.
Globalisierungskritiker im Aufwind
Seit einigen Jahren wird die Globalisierung aber auch zunehmend hinterfragt und kritisiert. Nichtregierungsorganisationen und Gewerkschaften weisen bereits seit Längerem auf die teilweise schlechten Arbeitsbedingungen und die tiefen Löhne in einigen Schwellenländern hin. Daneben ist ihnen die grosse Macht multinationaler Konzerne sowie die Zerstörung der Natur ein Dorn im Auge. Spätestens seit der Corona-Pandemie und dem Ukraine-Krieg hat aber auch bei Unternehmen und Politikern ein Umdenken stattgefunden. Anstelle der Globalisierung sorgt seither vermehrt die Deglobalisierung für Schlagzeilen. Tatsächlich hat der Welthandel im Verhältnis zur Industrieproduktion in den vergangenen Jahren bestenfalls stagniert. Welche Faktoren haben zu dieser Neubeurteilung geführt? Und mit welchen wirtschaftlichen Auswirkungen ist zu rechnen, wenn der freie Handel zunehmend eingeschränkt wird?
Handelskonflikt zwischen den Grossmächten
Die wachsende Skepsis gegenüber der Globalisierung ist vor allem unter der US-Präsidentschaft von Donald Trump ins öffentliche Bewusstsein gerückt. Das chronische Handelsbilanzdefizit der USA interpretierte er als Ergebnis von unfairen Praktiken der wichtigsten Handelspartner. Im Fokus stand dabei vor allem der strategische Rivale China, welchem er Diebstahl geistigen Eigentums sowie einen erzwungenen Technologietransfer vorwarf. So führte die US-Regierung im Jahr 2018 zunächst Importsteuern auf Produkte wie Solarpanels, Waschmaschinen sowie Aluminium und Stahl ein. Als die chinesische Regierung als Reaktion darauf ebenfalls Zölle auf ausgewählte US-Importe verhängte, eskalierte die Situation: Die Zölle wurden laufend erhöht und auf immer mehr Güterkategorien ausgedehnt. Schlussendlich waren fast zwei Drittel aller US-Importe aus China mit Zöllen belegt, in der Gegenrichtung waren es knapp 60 Prozent. Obschon sich beide Seiten Anfang 2020 schliesslich auf ein Teilabkommen einigen konnten, blieben die Strafzölle von durchschnittlich rund 20 Prozent in Kraft und wurden auch von der Regierung Biden nie infrage gestellt.
Sicherheitsfragen rücken in den Fokus
Die Angst der US-Regierung vor dem Aufstieg Chinas und dem eigenen Abstieg widerspiegelt sich mittlerweile aber nicht mehr nur in der Handelspolitik. US-Regierungsvertreter sprechen explizit von einer neuen Weltwirtschaftsordnung, die es zu gestalten gelte. Die Integration Chinas und Russlands in die Weltwirtschaft habe in beiden Ländern nicht den erhofften politischen Wandel mit sich gebracht. Gleichzeitig sei die industrielle Basis in den USA durch Auslagerungen in das billigere Ausland ausgehöhlt worden. Die US-Regierung verfolgt zu diesem Zweck seit Kurzem wieder eine aktive Industriepolitik. Dabei definiert der Staat, welche Sektoren für die nationale Sicherheit und das Wirtschaftswachstum von strategischer Bedeutung sind. In diese will er dann gezielt investieren. Mit dem Infrastructure Investment and Jobs Act, dem Chips and Science Act sowie dem Inflation Reduction Act wurden bereits drei wichtige Programme ins Leben gerufen, die Milliarden an Subventionen für ausgewählte Industriebereiche vorsehen. Ausserdem soll der technologische Vorsprung gegenüber China bewahrt werden. So haben die USA Beschränkungen für den Export hochentwickelter Halbleiter nach China erlassen. Die chinesische Regierung hat im Rahmen ihrer Bestrebungen nach Autarkie ähnliche Massnahmen eingeführt. Die Wirtschafts- und Handelspolitik wird somit immer stärker von sicherheits- und geopolitischen Fragen dominiert. Es droht eine Zweiteilung des Welthandels in einen USA-freundlichen und einen China-freundlichen Block.
Immer mehr diskriminierende Massnahmen
Der Handelskonflikt zwischen den beiden Grossmächten ist jedoch nur die Spitze des Eisberges. So haben seit der globalen Finanzkrise von 2008/09 und der damit verbundenen tiefen Rezession die protektionistischen Tendenzen weltweit stark zugenommen. Importzölle sind dabei nur ein Beispiel von staatlichen Interventionen. Weitaus häufiger zur Anwendung kamen in den vergangenen Jahren Subventionen, Exportfördermassnahmen sowie Importkontingente. Die am häufigsten betroffenen Güterkategorien sind Industriemetalle, Agrargüter sowie Automobile. Aber auch bei den Dienstleistungen und den Investitionen haben die staatlichen Einschränkungen stetig zugenommen.
Europa unter Druck
Die europäischen Regierungen haben gegen diese wettbewerbsverzerrenden Subventionen in den USA und in China protestiert, sahen sich aber letztlich doch zum Handeln gezwungen. So will die EU-Kommission mit dem European Chips Act und Investitionen von über EUR 40 Mrd. den europäischen Anteil an der globalen Halbleiterproduktion bis 2030 auf 20 Prozent verdoppeln. Es droht somit ein kostspieliger und schädlicher Subventionswettlauf. Deutschland zahlt derweil dem US-Chiphersteller Intel EUR 10 Mrd. Euro für den Bau einer Fabrik in Magdeburg, was mehr als EUR 1 Mio. pro Arbeitsplatz entspricht. Im Rahmen der neuen China-Strategie sollen einerseits geopolitische Risiken und kritische Abhängigkeiten reduziert werden, da das Reich der Mitte auch in Europa zunehmend als Systemrivale wahrgenommen wird. Anderseits sollen mit China aber weiter enge wirtschaftliche Beziehungen und Kooperationen zur Bewältigung globaler Herausforderungen bestehen («Derisking» statt «Decoupling»). Europa versucht damit, einen Ausweg aus der bipolaren Logik der Grossmächte zu finden und seine Interessen zu wahren. Dies ist nicht zuletzt auch eine Folge der grossen Bedeutung, die China für Europa als Absatzmarkt sowie als Hersteller vieler essenzieller Güter und Halbfabrikate hat. So stammen beispielsweise 90 Prozent der für die Energiewende dringend benötigten Solarpanels mittlerweile aus China.
Fragile Lieferketten unter der Lupe
Neben den Veränderungen auf politischer Ebene beginnen sich aber auch die Unternehmen neu auszurichten. Die Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen haben die hohe Anfälligkeit der globalen Lieferketten schonungslos offengelegt. Der Mangel an essenziellen Gütern wie Desinfektionsmitteln, Medikamenten und Computerchips hat gezeigt, wie hoch die Abhängigkeit von ausländischen Produzenten in einigen Bereichen geworden ist. Die Diversifikation der Lieferquellen ist nun das Gebot der Stunde. Gleichzeitig gewinnt auch die Lagerhaltung trotz der damit verbundenen Kosten an Bedeutung. Sicherheit und Verfügbarkeit von Materialien und Gütern werden wichtiger, während die bisher über alles gestellte wirtschaftliche Effizienz nicht mehr das alleinige Kriterium darstellt. Ähnliche Erfahrungen haben europäische Firmen mit dem Ukraine-Krieg und dem starken Anstieg der Gas- und Strompreise gemacht. Mit den gedrosselten Gaslieferungen aus Russland war plötzlich die Versorgungssicherheit gefährdet. Energieintensive Branchen sahen sich aus Kostengründen gezwungen, ihre Produktion stark zu drosseln oder ganz einzustellen. Das Schreckgespenst der Deindustrialisierung zieht derzeit insbesondere in Deutschland wieder seine Runden.
Das Ende des China-Booms und seine Folgen
Unabhängig von der Rivalität zwischen den beiden Grossmächten drängt sich für viele westliche Unternehmen zudem eine Neubewertung von China als Produktionsstandort auf. So sind mit dem hohen Wachstum der vergangenen Jahre auch die Löhne rasant gestiegen. Als China im Jahr 2001 der Welthandelsorganisation (WTO) beitrat, lag der durchschnittliche Lohn in den USA rund 30-mal höher. Zuletzt hat sich die Differenz auf den Faktor 3.5 verkleinert. Es ist also nicht mehr billig, in China zu produzieren. Dazu kommen die grossen strukturellen Probleme, die sich aus der Demografie, der hohen Verschuldung und der anhaltenden Immobilienkrise ergeben. Ebenfalls schwer wiegen die zahlreichen neuen chinesischen Gesetze und Verordnungen (z.B. Datensicherheitsgesetz oder Antispionagegesetz). Diese dienen vordergründig der nationalen Sicherheit. Sie sind jedoch sehr allgemein gefasst und sorgen bei ausländischen Firmen für grosse Unsicherheit. Es überrascht deshalb kaum, dass gemäss einer Umfrage der Europäischen Handelskammer in China fast zwei Drittel der Firmen der Ansicht sind, dass es schwieriger geworden ist, im Reich der Mitte Geschäfte zu machen. Mangels naheliegender Alternativen gibt es bisher aber auch kaum Produktionsverlagerungen in andere Schwellenländer. Die Folgen sind ausbleibende Investitionen und ein geringeres gesamtwirtschaftliches Wachstum.
Handelsrestriktionen haben ihren Preis
Das Fazit der jüngsten politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen ist somit klar: Globalisierung und Freihandel sehen sich zunehmend einem eisigen Gegenwind ausgesetzt. Die wachsende Anzahl an Handelshemmnissen wird nicht ohne Folgen bleiben: Das Wirtschaftswachstum wird tendenziell gebremst, während die höheren Kosten der Firmen preistreibend wirken. Die Produktion in den USA oder Europa bleibt trotz neuer Subventionen wesentlich teurer als jene in China, zumal der Fachkräftemangel im Westen eine grosse Herausforderung darstellt. Auch neue Technologien wie der 3D-Druck oder Fortschritte in der Robotik und der Automation sind nicht kostenlos zu haben und stellen nur bedingt eine Alternative dar. Insgesamt drohen somit Wohlstandsverluste, deren Ausmass schwierig abzuschätzen ist. Von einer breit abgestützten Deglobalisierung wie in der Periode von 1914 bis 1945 kann bisher aber noch nicht die Rede sein. So hat der Handel der USA und der EU mit China im vergangenen Jahr wertmässig weiter zugenommen. Die zunehmenden Einschränkungen dürften sich erst verzögert bemerkbar machen. Es ist deshalb offen, ob aus gesellschaftlicher Sicht der Nutzen von zusätzlicher Sicherheit die Kosten der wirtschaftlichen Einbussen zu kompensieren vermag.


