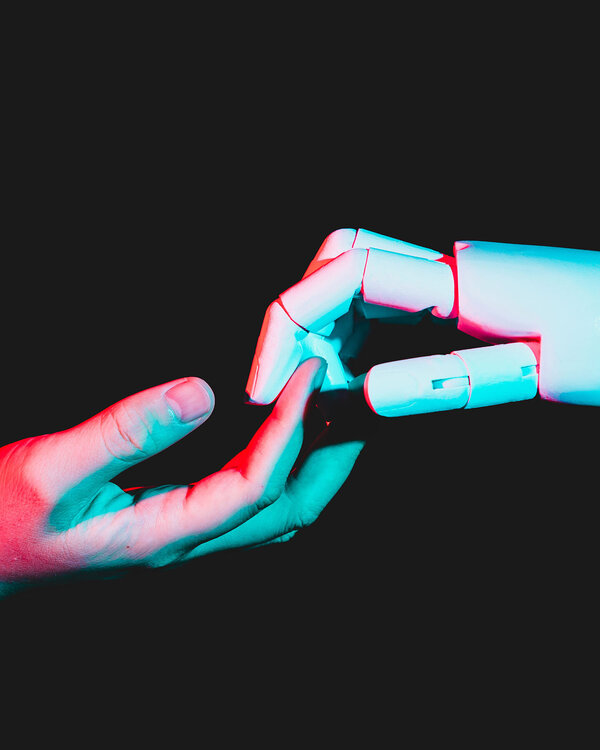Trends im Schweizer Arbeitsmarkt
Der Schweizer Arbeitsmarkt zeigt überraschende Entwicklungen: Wachstum in der Industrie, steigende Erwerbsbeteiligung von Frauen und Veränderungen bei Arbeitszeiten. Ein Blick auf 25 Jahre Wandel.
Text: David Marmet

Zur Jahrtausendwende wurde dem Schweizer Arbeitsmarkt die höchste Beschäftigungsquote aller OECD-Länder attestiert. Die Schweiz hatte zudem eine der höchsten Teilzeitquoten und eine der längsten Arbeitszeiten in Westeuropa. Kritisiert wurde, dass die Liberalisierung der Produktmärkte zu schleppend voranschreite und dies das Wachstumspotenzial begrenze. Wie hat sich der Schweizer Arbeitsmarkt seitdem in den letzten 25 Jahren entwickelt?
Zählte die Schweiz zur Jahrtausendwende noch vier Millionen Beschäftigte, sind es heute bereits über fünfeinhalb Millionen (+38%). Das höchste Wachstum verzeichnete die Genferseeregion, wobei die Nordwestschweiz mit den übrigen Regionen nicht mithalten konnte. Während in den meisten EU-Ländern die Deindustrialisierung in den letzten Jahrzehnten Fahrt aufgenommen hat, haben die Schweizer Industriebetriebe seit dem Jahr 2000 nochmals 110 000 Arbeitsplätze geschaffen. Auch hier war die Genferseeregion Spitzenreiterin, während in Zürich in diesem Sektor 5'000 Arbeitsplätze verloren gingen.
Innerhalb der Industrie kam es zu grösseren Verschiebungen. So verzeichneten beispielsweise die Nahrungsmittel und vor allem die Pharmaindustrie ein markantes Stellenwachstum, während die Maschinenindustrie schrumpfte. Auffallend ist, dass von Schweizer Industrieunternehmen im Ausland noch mehr Arbeitsplätze geschaffen wurden als im Inland. 93% des Beschäftigungszuwachses der letzten 25 Jahre entfallen indes auf den Dienstleistungssektor – und die Genferseeregion schwingt auch hier obenaus.
Frauen als Treiber des Beschäftigungswachstums
Das starke Beschäftigungswachstum war vor allem auf die verstärkte Erwerbsbeteiligung von Frauen zurückzuführen. So haben die von Frauen besetzten Stellen in den letzten 25 Jahren um 51% zugenommen, beinahe doppelt so stark wie der Anstieg bei den Männern (26%). Die Branchenauswertung zeigt aber, dass die Beschäftigung im Detailhandel und im Gastgewerbe – Branchen mit überdurchschnittlich hohem Frauenanteil – deutlich reduziert wurde. Ein massiver Stellenaufbau fand hingegen in den staatsnahen Sektoren statt. In der öffentlichen Verwaltung sind aktuell doppelt so viele Frauen beschäftigt wie zu Beginn der 2000er-Jahre. Dasselbe gilt für den Gesundheitssektor. Die Schweiz ist mit ihrem Stellenaufbau im staatsnahen Sektor in guter Gesellschaft. In vielen europäischen Staaten nimmt die Beschäftigung in der Verwaltung und im Gesundheitswesen nicht zuletzt aufgrund des demografischen Wandels überdurchschnittlich zu.
Veränderungen bei Arbeitszeiten
Arbeiteten die Männer in der Schweiz zur Jahrtausendwende im Durchschnitt noch 40 Stunden pro Woche, sind es heute knapp fünf Stunden weniger. Bei den Frauen ist die tatsächliche wöchentliche Arbeitszeit gerade mal um 0.7 Stunden auf rund 26 Stunden gesunken. Im Vergleich zu den an die Schweiz angrenzenden EU-Ländern wurde hierzulande die Arbeitszeit in den letzten 25 Jahren zwar stark reduziert, dennoch wird in der Schweiz pro Jahr über 200 Stunden mehr gearbeitet als im Nachbarland Deutschland.
Wie lautet das Fazit?
Das zur Jahrtausendwende prognostizierte beschäftigungslose Wachstum ist nicht eingetreten. Die Schweizer Wirtschaft ist durch Komplementarität und nicht durch Substitution gekennzeichnet. Insbesondere die Industrieunternehmen bauen sowohl im Ausland als auch im Inland Stellen auf – die Schweiz tanzt hier aus der Reihe. Bei den Teilzeitquoten und den Arbeitszeiten unterscheiden sich die Trends in der Schweiz hingegen nicht markant von jenen in der EU.