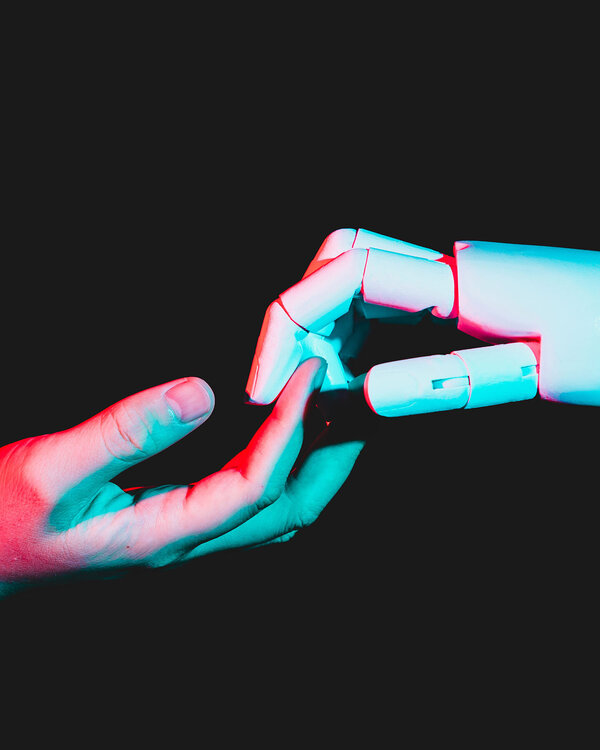Fulminantes Wachstum der Grenzgänger
Über 400'000 Grenzgängerinnen und Grenzgänger pendeln täglich zur Arbeit in die Schweiz. Trotz intensiver Debatte über die Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU bleibt das Thema weitgehend unbeachtet. Erfahren Sie im Beitrag, aus welchen Regionen am meisten Personen in die Schweiz zur Arbeit pendeln und was dies wirtschaftlich bedeutet.
Text: David Marmet

In der intensiv geführten Debatte über die Ausgestaltung der Beziehung zwischen der Schweiz und der EU kommt dem Thema Grenzgängerinnen und Grenzgänger wenig Aufmerksamkeit zu. Dies erstaunt, überqueren doch heute mehr als 400'000 Personen täglich die Grenze, um in der Schweiz zu arbeiten.In der intensiv geführten Debatte über die Ausgestaltung der Beziehung zwischen der Schweiz und der EU kommt dem Thema Grenzgängerinnen und Grenzgänger wenig Aufmerksamkeit zu. Dies erstaunt, überqueren doch heute mehr als 400'000 Personen täglich die Grenze, um in der Schweiz zu arbeiten.
Im Zuge des Personenfreizügigkeitsabkommens mit der EU wurde 2002 unter anderem der Zugang der Grenzgänger zum Schweizer Arbeitsmarkt liberalisiert. 160'000 Personen nutzten zu Beginn diese Form, in der Schweiz arbeiten zu können. Seither ist die Zahl der Grenzgängerinnen mit stupender Gleichmässigkeit gestiegen und liegt heute bei über 400'000.
Aus welchen Ländern pendeln die Grenzgänger in die Schweiz?
- 58 Prozent der Arbeitspendler kommen aus Frankreich. Davon arbeiten rund 50 Prozent in Genf und 20 Prozent im Kanton Waadt. Basel-Stadt folgt an dritter Stelle vor Neuenburg.
- Mit einem Anteil von 23 Prozent ist Italien das zweitwichtigste Grenzgängerland. 84 Prozenz der italienischen Arbeitskräfte sind im Tessin beschäftigt. In den Kanton Graubünden pendeln täglich knapp 10'000 Personen aus dem «Bel paese».
- An dritter Stelle folgt Deutschland, dessen Arbeitspendler kantonal breit gestreut sind. So arbeiten 25 Prozent in Basel-Stadt, 16 Prozent in Basel-Land und 15 Prozent im Kanton Zürich. Die Kantone Schaffhausen und Thurgau weisen Anteile von über 8 Prozent aus.
- Während die rund 750 liechtensteinischen Grenzgänger statistisch vernachlässigbar sind, beträgt der Grenzgängerstrom aus Österreich 2,2 Prozent. Was das Tessin für italienische Pendler bedeutet, ist St. Gallen für die österreichischen Grenzgänger, wo über 80 Prozent von ihnen arbeiten.

Seit der Einführung des Personenfreizügigkeitsabkommens mit der EU 2002 ist die Zahl der Grenzgängerinnen und Grenzgänger gleichmässig gestiegen und liegt heute bei über 400'000
David Marmet, Chefökonom Schweiz
Warensektor überwiegt
Überdurchschnittlich viele Grenzgängerinnen arbeiten in Branchen, die Waren herstellen. Von den insgesamt 5,5 Millionen inländischen Beschäftigten sind heute 13 Prozent im verarbeitenden Gewerbe angestellt. Bei den Grenzgängern liegt dieser Anteil bei 21 Prozent. Entsprechend weniger Grenzgängerinnen sind im Dienstleistungssektor zu finden. Insbesondere im Finanz- und im Gesundheitssektor sind unterdurchschnittlich viele Grenzgänger angestellt.
Befürworter und Kritiker
Manche wirtschaftspolitischen Entscheidungsträger argumentieren, Grenzgängerinnen würden dazu beitragen, den Fachkräftemangel zu reduzieren und die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Unternehmen zu steigern. Andere bemängeln den erhöhten Lohndruck auf lokale Arbeitskräfte, die zusätzliche Belastung der Infrastruktur und den Abfluss von Steuereinnahmen. Grenzgänger leben im angrenzenden Ausland, wodurch ihre Wohnorte von ihrem Konsum und einem Teil der anfallenden Steuern profitieren. Zudem beschönigen sie das Pro-Kopf-Wachstum, bemängeln Kritiker des fulminanten Wachstums der Grenzgänger, denn ihre Arbeitsleistung fliesst ins Schweizer Bruttoinlandsprodukt (BIP) ein, obschon sie nicht zu den Einwohnerinnen und Einwohnern der Schweiz zählen.
Eine Studie der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (KOF) zeigt indes: Grenzgänger konkurrieren nicht mit den einheimischen Arbeitskräften, sondern ergänzen sie. So nahm das Wirtschaftswachstum in den Grenzregionen seit der Arbeitsmarktliberalisierung markant zu, und die Löhne von hochqualifizierten Einheimischen stiegen überproportional – und das, obwohl zwei Drittel der Grenzgängerinnen ebenfalls hochqualifiziert sind.
Politisch nur ein Randthema
Dass Grenzgänger in der politischen Diskussion derzeit nur eine Randerscheinung sind, dürfte darauf zurückzuführen sein, dass die zusätzliche Verkehrsbelastung auf die Grenzregionen beschränkt ist, und vor allem darauf, dass sie die Wohnungsknappheit und den Mangel an Schulinfrastruktur nicht zusätzlich anheizen.