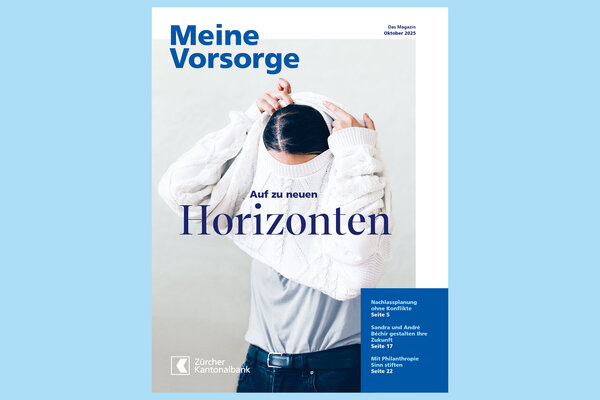«Sinn stiften – für uns und andere»
Joëlle Pianzola leitet die ZKB Philanthropie Stiftung. Im Interview spricht sie über die verschiedenen Formen gemeinnützigen Handelns, über die Motivationen von Donatorinnen und Donatoren und über die Wirkungen, die philanthropische Engagements erzielen können.
Interview: Patrick Steinemann / Bilder: Lea Meienberg / Illustration: Maria Salvatore | aus dem Magazin «Meine Vorsorge» 3/2025

Philanthropie bedeutet so viel wie eine «allgemeine Menschenliebe» – ein schöner Begriff. Wie definieren Sie ihn im Rahmen Ihrer Arbeit?
Im Grundsatz geht es darum, privates Geld für das Gemeinwohl einzusetzen. Philanthropisches Handeln bedeutet, mit dem zur Verfügung stehenden Vermögen Dinge zu ermöglichen, die einem persönlich wichtig sind und die gleichzeitig gesellschaftliche Wirkung entfalten.
Weltweit gibt es immer mehr Menschen mit viel Geld. Eine gute Ausgangslage für philanthropisches Handeln.
Ja, es gibt tatsächlich immer mehr philanthropische Engagements und immer mehr Stiftungen, auch in der Schweiz. Statistiken zeigen ein imposantes Wachstum über die letzten Jahre. Das hängt stark mit den weltweit steigenden Vermögen zusammen. Zudem gibt es immer mehr Menschen ohne Nachkommen. Diese Kombination begünstigt die Philanthropie.
Dr. Joëlle Pianzola
Dr. Joëlle Pianzola ist in der Nähe von Luzern aufgewachsen. Nach der Matura studierte sie Politikwissenschaft und Europarecht und promovierte im Bereich Behavioral Economics. Ihr beruflicher Weg führte sie in die Unternehmensberatung und in die Leitung eines Forschungsbereichs an der ETH Zürich. Zuletzt fungierte sie als Managing Director einer Corporate Foundation, bevor sie die Geschäftsführung der neu gegründeten ZKB Philanthropie Stiftung übernahm.
Was sind die Motive für Philanthropen, eine Stiftung zu gründen?
Die sind sehr unterschiedlich. Viele Menschen möchten etwas bewirken, und vielfach haben sie auch einen speziellen Bezug zu einem bestimmten Thema, sei dies durch persönliche Betroffenheit, durch ein spezifisches Erlebnis oder den Kontakt mit hilfsbedürftigen Menschen irgendwo auf der Welt. Wenn man die Stiftungszwecke ansieht, wird häufig eine persönliche Geschichte der Stifterinnen und Stifter spürbar. Es ist diese persönliche Note, die Stiftungen einzigartig machen.
Philanthropie kann auch den eigenen Status erhöhen.
Philanthropie wird sehr unterschiedlich gelebt. Im angelsächsischen Raum gehört es zum guten Ton, dass vermögende Menschen «Charity» betreiben – da spielt der Status sicher eine gewisse Rolle. In der Schweiz wird die Philanthropie viel diskreter ausgeübt: Hier tun viele Menschen Gutes, sie wollen aber nicht, dass andere davon erfahren – sie handeln also stärker aus einer intrinsischen Motivation heraus. Oft haben Menschen, die sich philanthropisches Wirken leisten können, auch schon einiges erreicht im Leben und der positive Beitrag zur Gesellschaft überwiegt den Anerkennungswunsch.
Welche Wirkung haben philanthropische Engagements in der Gesellschaft?
Philanthropie wird neben der öffentlichen Hand und der Privatwirtschaft als dritter Sektor im gesellschaftlichen Gefüge bezeichnet. Sie bewegt dort, wo die anderen beiden Sektoren Lücken aufweisen. Und sie wirkt da, wo es noch mehr in unserer Gesellschaft zu tun gibt.
2024 hat die Zürcher Kantonalbank die ZKB Philanthropie Stiftung gegründet. Wie ist der Betrieb angelaufen?
Sehr gut. Die Stiftung stösst auf grosses Interesse und wir haben uns intensiv um die grundlegenden Aufbauarbeiten gekümmert: Die Steuerungsrichtung steht und wichtige Leitplanken sind gesetzt. Seit Anfang 2025 ist die Stiftung nun fördernd tätig.
Weshalb engagiert sich die ZKB im philanthropischen Bereich?
Die ZKB setzt sich seit jeher als Bank auch für das Gemeinwohl ein. Mit der ZKB Philanthropie Stiftung hat sie nun eine Rechtsform geschaffen, wo nebst dem eigenen auch das philanthropische Engagement von Donatorinnen und Donatoren in vielfältiger Weise verwirklicht werden kann. Der hybride Charakter unsere Stiftung ermöglicht es, als Dachstiftung eine Plattform für die Gründung von unselbständigen Stiftungen zu bieten und gleichzeitig mit den eigenen Mitteln als Förderstiftung tätig zu sein.
Mit einem Stiftungskapital von 25 Millionen Franken und fünf thematischen Bereichen ist die Förderstiftung breit aufgestellt. Welche Idee steckt dahinter?
Im Rahmen der Förderstiftung setzen wir unsere Mittel mit Wirkung für den Kanton Zürich ein. Hier möchten wir möglichst vielfältig tätig sein und unterschiedlichste gemeinnützige Zwecke fördern, um gesellschaftlichen Nutzen zu stiften.

Wir Menschen streben nach Sinnstiftung – etwas, das grösser ist als wir selbst. Da ist Philanthropie ein grossartiges Instrument.
Joëlle Pianzola, Leiterin ZKB Philanthropie Stiftung
Die ZKB hat auch zahlreiche Sponsoring-Engagements. Wo gibt es Gemeinsamkeiten und wo Abgrenzungen?
Die Stiftung wie auch das Sponsoring setzen sich für den Kanton Zürich ein. Das Sponsoring-Engagement der Bank ist Teil des Leistungsauftrags, den die ZKB hat. Sponsoring ist im Grundsatz mit einer Gegenleistung verknüpft, man gibt etwas und man erhält etwas. Dem gegenüber engagiert sich die Stiftung ausschliesslich im gemeinnützigen Bereich: Sie stiftet Geld für einen guten Zweck. Die Stiftung will eine Wirkung erzielen, es gibt aber keinerlei kommerzielle Gegeninteressen.
Gibt es schon erste Projekte und Engagements, welche die Förderstiftung unterstützt?
Ja, wir machen seit Anfang 2025 Vergabungen. Dabei unterstützen wir Förderpartner in unterschiedlichen Bereichen. So unterstützen wir etwa eine Organisation, die ein Ökosystem für Social Entrepreneurship aufbaut. Dabei werden wirkungsorientierte Unternehmen unterstützt, bei denen nicht der reine Profit im Fokus steht, sondern die gesellschaftliche Wirkung. Daneben unterstützen wir aktuell Organisationen, welche die Angehörigen von psychisch kranken Menschen unterstützen oder sich um die Chancengleichheit im Bildungswesen kümmern. Zudem fördern wir eine Organisation, die sich für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf einsetzt.
Geld zu verschenken, das tönt nach einer schönen Aufgabe. Dabei ist die Auswahl der Empfänger wohl gar nicht so einfach.
In der Tat. Wir wollen ja eine nachhaltige Wirkung erzielen – und da spielen schnell einige Kriterien eine Rolle bei den Vergabungen. Neben dem bereits genannten geografischen Fokus auf den Kanton Zürich und der Konzentration auf Organisationen statt Einzelpersonen spielt auch die Reputation der Förderpartner eine Rolle. Zudem schauen wir auf eine breite Finanzierung der Organisationen für eine langfristige Wirkung, auf ihre Projektansätze und die involvierten Personen.

Die ZKB Philanthropie Stiftung ist auch eine Dachstiftung, innerhalb derer Donatorinnen und Donatoren eine eigene Substiftung eröffnen können. Wie funktioniert ein solches Konstrukt?
Eine Substiftung ist quasi eine Stiftung innerhalb einer Stiftung. Wie bei einer normalen Stiftung müssen bei einer Substiftung zunächst der Zweck und die Wirkung definiert werden. Ebenfalls kann ein Substiftungsrat eingesetzt werden, der über die Verwendung der Gelder mitentscheidet. Durch die Einbettung in die Dachstiftung wird die Administration jedoch deutlich vereinfacht, und es fallen weniger Kosten an. So kümmern wir uns etwa um alle regulatorischen und behördlichen Belange. Eine Substiftung unter unserem Dach ist auch von Beginn an steuerbefreit. Die vorhandenen Mittel können somit hauptsächlich für den definierten Zweck eingesetzt werden.
Mit einer Substiftung können also eigene Akzente gesetzt werden.
Genau. Es sind immer individuelle Zwecke, die zur Umsetzung kommen. Ausschlaggebend ist die Frage, wie stark man selbst aktiv sein möchte. Und ob man auch die nötige Zeit dafür aufbringen kann. Wer hingegen eher eine einmalige Spenderin oder ein Spender sein möchte, der kann sein Geld auch in einzelne thematische Gefässe der Förderstiftung übertragen und unseren Expertinnen und Experten die Umsetzung überlassen.
Längst nicht alle handeln nach der «Menschenliebe» der Philanthropie: Individualismus und Egoismus scheinen heute immer mehr zu dominieren.
Dieser Trend ist klar da, ich betrachte ihn jedoch aus einer positiven Perspektive für die Philanthropie. Durch die Individualisierung geht auch der grössere Sinn im Leben etwas verloren. Wir Menschen haben aber ein grundlegendes Bedürfnis nach Sinnstiftung – etwas, dass uns Orientierung verschafft und das grösser ist als wir selbst. Und gerade in dieser Konstellation ist Philanthropie ein grossartiges Instrument: Wir können aus einer individuellen Perspektive heraus Sinn stiften – für uns und andere. Dadurch werden wir wiederum Teil eines grösseren Ganzen, das Zugehörigkeit schafft.

Darauf kommt es an
- Prüfen Sie Ihre Möglichkeiten: Wie viel Wissen haben Sie über den philanthropischen Bereich? Wie viel Zeit möchten Sie für Ihre gemeinnützige Tätigkeit aufbringen? Und welche Mittel haben Sie zur Verfügung? Die Antworten zu diesen Fragen helfen Ihnen, die Art und den Umfang Ihres Engagements zu definieren.
- Machen Sie sich Gedanken zur Form: Wollen Sie eine direkte Spende an gemeinnützige Institutionen leisten, eine eigene Stiftung gründen oder ziehen Sie eine Lösung innerhalb einer Dachstiftung vor? Die Form ist unter anderem abhängig von Ihrem Wissen, Ihrer zeitlichen Verfügbarkeit sowie den finanziellen Mitteln.
- Wählen Sie das passende Gefäss: Eine selbstständige Stiftung erfordert Wissen und Zeit sowie die Bereitschaft, die Stiftung selber zu verwalten oder verwalten zu lassen. Wenn Sie sich auf die Wirkung Ihrer Spenden konzentrieren und sich administrativ entlasten möchten, ist eine Substiftung innerhalb einer Dachstiftung die geeignetere Lösung.
- Befassen Sie sich mit dem Zweck: Unabhängig von der gewählten Lösung lautet die Kernfrage, welchen gemeinnützigen Zweck Sie unterstützen möchten. Von Vorteil ist ein etwas breiter formulierter Zweck, um der Stiftung langfristig genügend Handlungsfreiheit zu geben und den Stifterwillen bestmöglich umzusetzen.